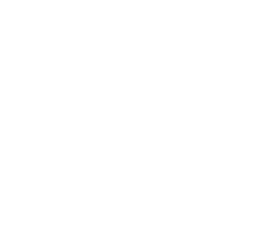„Der Islamismus hat mit dem Islam nichts zu tun“ – eine westliche Illusion
„Politischer Islam“, „Islamismus“, „legalistischer Islamismus“, so oder ähnlich lauten die Etikette, mit denen man die Europa beunruhigenden Gegebenheiten kennzeichnet, die zwar irgendwie mit der Religion „Islam“ in Verbindung stehen, aber möglichst nichts mit ihm zu tun haben sollen. Denn ließe man diesen Gedanken zu, dann müsste man die kräftig wachsende muslimische Glaubensgemeinschaft unter einen, wie man zu sagen pflegt, „Generalverdacht“ stellen. Man müsste einräumen, dass der Islam mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der zeitgenössischen hiesigen Verfassungen nicht vereinbar ist, zumindest nicht mit deren grundlegenden Prinzipien. Indem man begrifflich einen politisch ambitionierten Islam von einem rein religiösen zu trennen hofft, glaubt man, einer ins Grundsätzliche gehenden Auseinandersetzung mit den islamischen Lehren von Gott, Welt und Gemeinwesen zu entkommen; denn diese verliefe, das ahnt man, äußerst konfliktreich. Daher nimmt man lieber an, die zeitgenössische europäische Auffassung von Religion als einer rein privaten Angelegenheit sei universal gültig, treffe mithin auch auf die Muslime zu. In die Religionspraxis habe das Gemeinwesen nicht hineinzureden, während die Machtausübung, das Politische und Gesellschaftliche im weitesten Sinne der von den Verfassungen zu regelnden Sphäre des Daseins anheimgegeben seien. Für diese Sphäre das Religiöse in Anspruch zu nehmen, sei mithin ein „Missbrauch der Religion“. Ihn hätte man den Verfechtern eines politischen Islams vorzuwerfen.
Dies ist eine ganz und gar eurozentrische Sichtweise. Denn jeder, der nur ein wenig mit islamischem Denken und islamischem Schrifttum in Berührung gekommen ist, wird auf die muslimische Überzeugung gestoßen sein, dass es im Islam keine Trennung von Religion und Machtausübung beziehungsweise Politik gibt. Diese islamische Grundhaltung ist nicht etwa, wie man bisweilen liest, während der ins 19. Jahrhundert zurückreichenden islamischen Abwehr gegen den Westen entstanden. Die Verwobenheit der für den modernen Europäer zumindest konzeptuell gegeneinander abzugrenzenden Bereiche ist vielmehr für den Islam von Anfang an charakteristisch. Da nach islamischem Selbstverständnis die durch den Propheten Mohammed in Medina in den Jahren 622 bis 632 n. Chr. aufgebaute Urgemeinde bis auf den heutigen Tag den Maßstab für alle wahrhaft islamischen Verhältnisse bildet, ist zuvörderst ein Blick auf die für unser Thema grundlegenden Gegebenheiten zu werfen, die dieser Maßstab vorschreibt.
Der Islam tritt als ein Gemeinwesen eigener Art in die Weltgeschichte ein. Anders als etwa das Christentum setzt er sich nicht in vorgefundenen politischen Gebilden fest, sondern versteht sich selber als das dank der göttlichen Botschaft ins Leben gerufene Machtgefüge, das der „Rechtleitung“ durch Allah anheimgegeben ist. Mohammed agiert als der Sachwalter Allahs, des eigentlichen Herrschers. Dieser ist Herrscher in einem ungleich weiteren Sinn, als es ein Mensch je sein könnte. Denn Allah, der eine das Diesseits ununterbrochen hervorbringende und lenkende Schöpfer, hat kraft seiner unbezwingbaren Bestimmungsmacht nicht nur das „politische“ Sagen inne, sondern schafft zugleich fortwährend das diesem Sagen unterworfene Sein. Anders gesagt: Das dank Allah ständig ins Dasein tretende Diesseits findet mit der Gründung des islamischen Gemeinwesens erst eigentlich zu sich selber; Sein und Seinsollen bilden fortan die Allah gefällige Harmonie. Es ist die Aufgabe der Muslime, diese Harmonie zu wahren und über den ganzen Erdball auszubreiten. Diese Überzeugungen werden von allen Strömungen des Islams geteilt, und mir ist nie ein Muslim begegnet, der sie in Abrede gestellt hätte.
Im Laufe des 7. bis 10. Jahrhunderts n. Chr. bildet sich die muslimische Auffassung von Mohammed heraus: Er wird zu der Gestalt stilisiert, die die göttliche „Rechtleitung“ in ihrem Denken, Reden und Handeln rückhaltlos verwirklicht habe. Im Schiitentum treten Männer aus der Nachkommenschaft seines Vetters Ali (ca. 600-660) an seine Seite; auch diese „Imame“ seien kraft des ihnen eigenen Charismas der göttlichen „Rechtleitung“ teilhaftig gewesen, wenn auch in geringerem Maße als Mohammed selber. In der Befolgung der „Rechtleitung“ liegt die Harmonie zwischen Sein und Seinsollen begründet, nicht aber in Erwägungen, mit denen der Mensch mittels seines Verstandes das fortwährende göttliche Schöpfungshandeln durchforschen und aus den gewonnenen Erkenntnissen Schlüsse auf das Seinsollen ziehen könnte. Die Grundlage dieser Anschauung findet sich im Koran in der Passage über die Erschaffung des Menschen (Sure 2, 30–39). Allah kündigt den Engeln an, dass er auf der Erde einen Stellvertreter einsetzen werde. Sie befürchten, dass das neue Wesen Unheil stiften werde, doch Allah weist die Bedenken zurück. Er stattet Adam nämlich mit Wissen über die Geschöpfe aus, sodass er sie benennen kann. Den Engeln fehlt solches Wissen. Ihnen befiehlt Allah, sich vor Adam niederzuwerfen. Sie gehorchen alle bis auf den Satan, der aus seiner edleren Beschaffenheit – er besteht aus Feuer, Adam aus Lehm – den Schluss zog, er brauche dem Befehl nicht Folge zu leisten (hierzu auch Sure 15, 26–34). Adam und seine Gattin leben im Paradies, dürfen aber die Frucht eines bestimmten Baumes nicht genießen. Der Satan überredet sie, das Verbot zu übertreten, und so werden beide zusammen mit dem Satan des Paradieses verwiesen. Doch in ebendiesem Augenblick wendet sich Allah wieder gnädig Adam zu: „Wenn von mir zu euch eine ‚Rechtleitungʻ kommt, dann brauchen diejenigen, die ihr folgen, sich nicht (vor dem Endgericht) zu ängstigen …“ Der Satan und seine Spießgesellen freilich dürfen mit Allahs Erlaubnis die Menschen zum Ungehorsam gegen die Rechtleitung zu verführen suchen (Sure 15, 39–48; vgl. Sure 7, 24). Denn Allah hat die Hölle geschaffen und will sie mit denjenigen anfüllen, denen er solchen Ungehorsam als Lebensschicksal vorherbestimmt hat (Sure 11, 105–119).
Mit der „Rechtleitung“ hat der Muslim den Maßstab zur Verfügung, dessen Beachtung ihm das Bestehen im Endgericht ermöglichen kann, wobei jedoch nicht anzuzweifeln ist, dass solche Beachtung ihm von Allah bestimmt sein muss. Denn aus eigener Kraft und aus eigenem Entschluss ist ihm dies nicht möglich. So bleibt dem Menschen nichts anderes, als sich an das Wissen zu halten, das Allah schon Adam lehrte (Sure 2, 31 f.). Mit diesem Wissen, der gottgegebenen Auslegung des Wesens Allahs, der Welt und des Daseins in ihr, kurz: mit dem Islam vollendet Allah die Schaffung des Menschen. Dieser hat demnach nicht die Fähigkeit, das aus dem Schöpfungshandeln Allahs folgende Seinsollen selber zu ermitteln; er griffe mit solchem Vorwitz in die Zuständigkeiten Allahs ein. Dieser Glaubenssatz behauptet sich bis in die Gegenwart. Er taucht in der Präambel islamischer Menschenrechtserklärungen auf, wo gesagt wird, der Mensch sei durch Allah zum „Stellvertreter“ bestellt worden. Nicht die Einhauchung des Geistes in die Gestalt Adams vollendet diesen, sondern die Unterweisung „in allen Namen“, wie es im Koran wörtlich heißt, nämlich die Übermittlung alles Wissens, das dem Menschen nach Allahs Ratschluss zuträglich ist und das im übrigen nicht durch eigenes Erkenntnisstreben erweitert werden kann. Solches Streben führt zu Pseudowissen: Der Satan vermeinte dank einem Verstandesschluss, er dürfe sich einem Befehl Allahs widersetzen, und er mochte sich zu diesem Schluss befugt fühlen, weil es doch eine schwere Verfehlung ist, sich vor einem geschaffenen Wesen in Verehrung niederzuwerfen. Das ist in der Tat verboten: „Beigesellung“, d.h. jemand anderen als Allah anzubeten, ist eine widerislamische Handlung. Aber einem Befehl Allahs auf Grund eigenständiger Überlegungen die Folge zu verweigern, wiegt noch schwerer.
Die Schaffung des Menschen ist, wie aus alldem folgt, erst dann vollendet, wenn ihm das islamische Wissen zuteil geworden ist, und dieses ist mit den gottgegebenen Normen identisch, die in einem Spannungsverhältnis zu dem stehen, was der Mensch mit seinem Verstand ersinnt. Es ist zwar so, dass menschengemachte Rechtsordnungen den Diebstahl unter Strafe stellen, aber für einen Muslim, der in einem Land mit einer menschengemachten Rechtsordnung lebt, ist deren Norm nicht entscheidend, sondern allein der Umstand, dass die Scharia den Diebstahl untersagt. Dies ist Teil der göttlichen „Rechtleitung“, und diese ist prinzipiell nur in einem islamischen Gemeinwesen in Kraft. Ihre Funktion ist es, den Muslimen bzw. den Menschen überhaupt die Erfüllung des Zweckes zu ermöglichen, zu dem Allah ihn – und die Dämonen – geschaffen hat und fortwährend schafft, nämlich Ihn anzubeten (Sure 51, 56). Die übrigen Geschöpfe – die unbelebte Materie, die Pflanzen, die Tiere, die Engel – existieren wesensmäßig im Modus des Lobpreisens Allahs. Die Dämonen und die Menschen, die mit dem Verstand ausgestatteten Geschöpfe, haben ihn erhalten, um die Lobpreisung Allahs ohne Unterlass mit klarem Bewusstsein auszuführen. Der von Allah beabsichtigte Gebrauch des Verstandes hätte dem Satan die Einsicht vermitteln müssen, dass er dem Befehl Allahs unverzüglich und ohne eigenes Räsonieren hätte gehorchen müssen.
„Rezitiere, was dir als Schrift eingegeben wurde, und verrichte das rituelle Gebet!“ befiehlt Allah seinem Propheten in Sure 29, Vers 45, und fügt hinzu: „Das Gebet nämlich verbietet, das Abscheuliche und Verwerfliche (zu tun). Aber Allahs zu gedenken, hat noch mehr Gewicht.“ Die Worte des Korans und der Gebetsritus, in dem diese einen festen Platz haben, halten den Muslim in der harmonischen Einheit von Sein und Seinsollen. Für die Zeit, die er außerhalb der Rezitation und des Ritenvollzugs verbringt, ist das Gottesgedenken dringend zu empfehlen. Dieses entwickelt sich nach Mohammeds Tod zu einer am besten in Gemeinschaft zu vollziehenden Frömmigkeitsübung. Im Idealfall befähigt sie den Muslim, bei jeder Handlung Allah im Sinn zu haben. Eine breite Literatur beschäftigt sich mit diesem Gegenstand und gibt auch ganz praktische Anweisungen, wie dieses Ideal im Alltag zu verwirklichen sei und woran der Glaubende erkennen könne, ob er diesem Ideal beispielsweise nach zehntausendfachem Aussprechen des Wortes „Allah“ nahegekommen ist.
Eine solche private Anstrengung um die Verwirklichung des Islams, der vollständigen Anheimgabe der Person an den alles Schaffenden und Bestimmenden, steht im Einklang mit dem Daseinszweck des islamischen Gemeinwesens, der im ersten Satz von Sure 29, Vers 45, angedeutet wird: Es ist die Organisierung der von Allah als Dank für sein fortwährendes Schaffen eingeforderten kollektiven Verehrung durch die Riten, an erster Stelle durch das fünfmal am Tag auszuführende Pflichtgebet. Dieses setzt sich aus Worten und Bewegungsabläufen zusammen, die nach muslimischer Auffassung unmittelbar von Allah angeordnet wurden; im Pflichtgebet steht der Muslim unmittelbar vor Ihm und in einem Raum, der gegen die Tücken des Satans abgeschirmt ist. Allahs Gemeinwesen tritt somit während des Ritenvollzugs in Erscheinung. Es ist daher in höchstem Maß empfehlenswert, die Pflichtgebete nicht allein, sondern in Gemeinschaft auszuführen. Einer aus der Gemeinschaft der Betenden ist hierbei zum Vorbeter, zum Imam, zu bestellen. Dieser erfüllt zwei wesentliche Aufgaben: Er leitet erstens die mit ihm Betenden an, sodass sie seinen Bewegungen folgen, und zwar selbst dann, wenn ihm Fehler unterlaufen sollten. Denjenigen, die ihn „nachahmen“, werden diese Fehler nicht negativ auf ihr Jenseitskonto angerechnet. Auch der Vorbeter darf auf Allahs Nachsicht hoffen, sofern er die Fehler nicht willentlich gemacht hat. Die Gemeinschaftlichkeit des Ritenvollzugs ist der übergeordnete Gesichtspunkt. Zweitens dient der Imam als Schutzschild gegen die Verführungskünste des Satans und gewährleistet dadurch, dass Engel Allah über die Ritentreue in Kenntnis setzen. Auch zu diesem Thema gibt es eine schier uferlose Literatur.
In den gemeinschaftlich vollzogenen Pflichtgebeten und besonders während des Freitagsgottesdiensts, an dem jeder religionsmündige Mann teilzunehmen hat, zeigte sich die medinensische Gemeinde als ein Gemeinwesen eigener Art, unterschieden von allen anderen: Mohammed als Sprecher Allahs, des eigentlichen Herrschers, hatte die Leitung dieser Veranstaltungen inne. Befand er sich auf einem Feldzug, übernahm diese Aufgaben ein von ihm eingesetzter Vertreter. Wenn Mohammed nicht selber in den Krieg zog, fungierte der von ihm ernannte Heerführer als Leiter der Riten außerhalb Medinas. Hieraus ergab sich, als sich die Eroberungen nach Mohammeds Tod rasch beschleunigten und vermehrten, die Art der Inbesitznahme unterworfener Territorien: Sie war zunächst nichts anderes als die Beseitigung der vorgefundenen Machtverhältnisse und die Ausbeutung der Unterworfenen; diese wurden von Militärlagern aus in Schach gehalten oder von eingenommenen Metropolen aus wie etwa Damaskus, die zu islamischen Zwecken umgestaltet wurden. Das Zentrum bildete ein großer Platz, auf dem die rituellen Gebete und der Freitagsgottesdienst abgehalten wurden, geleitet durch den jeweiligen Militärführer, der durch den in Medina residierenden Nachfolger des Propheten ernannt worden war. Er hatte die Aufgabe, die Mohammed einst in Medina innegehabt hatte, nämlich durch die Organisierung der Ritualpflichten die Existenz des Gemeinwesens Allahs zu gewährleisten. Das islamische Schrifttum über dessen Grundzüge beschäftigt sich dementsprechend in erster Linie mit Fragen der Legitimität der Machthaber. Diese wird dadurch erwiesen, dass er – selbst über viele Stufen vermittelt – die medinensischen Amtsgeschäfte des Propheten fortführt, ohne freilich wie dieser einst in der unmittelbaren, „lebendigen“ „Rechtleitung“ durch Allah zu stehen. Wie trotzdem die „Rechtleitung“ der beherrschten Muslime aufrechterhalten werden könne, sei es in der Anwendung des durch die Gelehrten bewahrten und ausgelegten gottgegebenen Wissens, sei es dank einem durch die Verwandtschaft mit Mohammed gegebenen Charisma, war in der islamischen Geschichte heftig umstritten und löste Zerwürfnisse aus, die bis heute nicht bereinigt werden konnten. Unbestritten aber ist in jedem Fall, dass Machtausübung und Religionsausübung einen unauflöslichen Zusammenhang bilden.
Die islamische „Staatstheorie“ sorgt sich vor allem um die Bewahrung der Legitimität der Machtausübung gemäß dem medinensischen Vorbild. Sie bezieht sich auf Aussagen des Korans und besonders des Hadith, Mohammed zugeschriebener Sätze und Handlungen, die die Zeit der frühen Eroberungen (etwa 630–720 n. Chr.) widerspiegeln. Sie sehen als wichtigste Pflicht des Machthabers die „gerechte“ Verteilung der Güter vor, die durch die Eroberungen und die Ausbeutung der nichtmuslimischen Unterworfenen gewonnen wurden.
Auch das islamische Gemeinwesen konnte freilich nicht dauerhaft auf Institutionen der Wahrung der inneren Ordnung verzichten, die ohne die Erträge aus ständiger Expansion zu finanzieren waren. Da nennenswerte Abgaben sowie Zölle und ähnliche „Staatseinkünfte“ im Koran und im Hadith nicht vorkommen, also nicht mit der göttlichen „Rechtleitung“ zu vereinbaren sind, war die Machtausübung in Perioden stagnierender Ausdehnung beeinträchtigt und wurde durch die Gesetzesgelehrten stets eines unislamischen Charakters geziehen, eben weil sie sich Mittel auf Wegen verschaffen musste, die Koran und Hadith nicht kennen. So scheiterte noch in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts der Versuch, in Tunesien einen am europäischen Vorbild orientierten Staat aufzubauen, an der Unmöglichkeit, ein hierfür unerlässliches nicht-schariatisches Abgabensystem zu etablieren.
Die aus dem Medinamodell folgende Verpflichtung, die islamische Machtausübung über den ganzen Erdball auszudehnen, schlägt sich im Konzept der Zweiteilung der Welt nieder. Dem „Gebiet des Islams“ steht das „Gebiet des Krieges“ gegenüber, jene Territorien, die einer islamischen Machtausübung und somit der von Allah beabsichtigten Harmonie von Sein und Seinsollen beziehungsweise der göttlichen „Rechtleitung“ noch zu unterwerfen sind. Diesem Ziel dient unter anderem der Dschihad, der zwar nie die allgemeine Anerkennung als einer jedem Muslim obliegenden Glaubenspflicht fand. Aber nach schariatischer Lehre darf der Kampf des Gemeinwesens um die Ausweitung seiner Herrschaft niemals erlahmen, wenn die Machthaber ihre Legitimität bewahren wollen. Der Dschihad wird dementsprechend als eine Glaubenspflicht verstanden, die stets von einer hinreichend großen Anzahl von Menschen wahrzunehmen ist. Da es im Islam keine zentrale Lehrautorität gibt, die festzustellen befugt wäre, ob dies tatsächlich geschieht, dürfen Muslime, die eine mangelnde Dschihadbereitschaft diagnostizieren, auf eigene Faust aktiv werden. Die Scharia empfiehlt dies ausdrücklich, zumal, wenn man bemerke, dass die bestehende islamische Herrschaft gefährdet sei. Der Dschihad wird in einem solchen Fall eine jedem Muslim obliegende Pflicht.
Verbunden mit der institutionellen Schwäche islamischer Herrschaft hat diese schariatische Konstruktion die außerordentliche Instabilität der islamischen Geschichte verursacht und immer wieder dazu geführt, dass sich Umsturzbewegungen durchsetzten, die mit dem Anspruch auftraten, dem Medinamodell Geltung zu verschaffen. Deren Anführer ließen sich durch Schariagelehrte bestätigen, dass sie im genannten Sinn legitim handelten. Ihre despotische Machtausübung erfolgt somit formal zur Verwirklichung des mohammedschen Erbes, und zur Bekräftigung dieser Behauptung lassen sich im Koran und im Hadith immer wieder genügend „Belege“ finden. Dynastien wie die Osmanen vermochten ihre Despotie über Jahrhunderte dank einer weiteren wirkmächtigen Folge der institutionellen Schwäche aufrechtzuerhalten: Sie ließen es zu, dass die faktische Machtausübung an regionale Notabeln überging; die Sultansherrschaft wurde mediatisiert, ohne dass den Sultanen formal die Loyalität aufgekündigt worden wäre.
Das „Gebiet des Krieges“ wird in der schariatischen Literatur nie als ein gleichwertiger Mitspieler auf dem Parkett der Weltpolitik betrachtet. Muslime sollten sich dort nicht auf Dauer aufhalten, damit den Ungläubigen daraus kein Nutzen erwachse. Nur in Situationen, in denen die islamische Macht die unterlegene ist, dürfen die Muslime einen Waffenstillstand schließen, der allerdings nicht unbefristet sein darf. Dass Muslime in großer Zahl unter nichtmuslimische Herrschaft geraten, ist in der Scharia nicht vorgesehen, zumal eine nichtislamische Staatsautorität weder befugt noch befähigt sein kann, den Daseinszweck eines islamischen Gemeinwesens, die Bewahrung der „Rechtleitung“ im Rahmen der Organisierung der Ritualpflichten und eines islamischen Gerichtswesens, zu erfüllen. Als Muslime auf dem Balkan Staaten anderen Glaubens unterstellt wurden, half man sich auf muslimischer Seite mit der Annahme, da auf den betroffenen Gebieten die Ritualpflichten eingehalten würden, befänden sich diese bereits in der Rückverwandlung in „Gebiete des Islams“. Für diesen als vorübergehend angesehenen Zustand ersann man das Konstrukt des „Gebiets des Vertrags“, nämlich mit dem nichtmuslimischen Staat. Man muss diesen „Vertrag“ aus der Sicht der Muslime bewerten: Sie sind nicht eine Religionsgemeinschaft unter anderen, sondern die einzige wahre. Nicht die Verfassung des jeweiligen nichtislamischen Staates gewährt ihnen die Freiheit des Ritenvollzugs, sondern diese kommt ihnen von Allahs wegen zu. Deshalb das Verlangen nach einer vertraglichen Sonderstellung, die übrigens auch unter Schariagelehrten nicht unumstritten ist, da sie die traditionelle Zweiteilung der Welt verschleiere.
Das Ziel, das sich für den Muslim aus der Zweiteilung des Erdkreises ergibt, nämlich diese im Zuge der Islamisierung der Ungläubigen zu überwinden, ist nach wie vor gültig. Die seit dem 19. Jahrhundert dringlich gewordene Auseinandersetzung mit der westlichen Zivilisation wird unter diesem Gesichtspunkt betrieben. Es wird nicht bestritten, dass die Übernahme der technischen Seite dieser Zivilisation unvermeidbar ist. Aber indem diese erfolgt, ist so streng wie irgend möglich auf die Bewahrung des islamischen Charakters des übernehmenden Gemeinwesens zu achten, und zwar aus zweierlei Gründen: Zum einen stärkt diese Zivilisation, die ja nicht in der Scharia vorgesehen ist, die despotische Machtausübung und beeinträchtigt die „Rechtleitung“; es muss also ermittelt werden, ob beziehungsweise inwiefern willkommene Erscheinungsformen der westlichen Zivilisation nachträglich für schariakonform erklärt werden können, eine Aufgabe, der sich die Schariagelehrten seit dem späten 19. Jahrhundert widmen. Noch dringlicher aber ist zum anderen die offensive Zurückweisung des westlichen Überlegenheitsanspruchs, der sich in der Anziehungskraft dieser Zivilisation manifestiert. Der Islam sei die eine verstandesgemäße Religion, eben weil der Verstand den Schluss nicht abweisen könne, dass der Koran und das Hadith wahr sein müssten, da sich in ihnen der eine Schöpfer kundgebe; wegen dieser Verstandesgemäßheit des Islams sei dieser die einzig mögliche Religion des mit dem Verstand begnadeten Menschen, und es sei durchaus gerechtfertigt, ihr auch mit Gewalt zum Sieg zu verhelfen, wenn andere Mittel ihn nicht herbeiführen könnten.
Diese Vorstellungen beherrschen ein seit anderthalb Jahrhunderten unüberschaubar weites islamisches Schrifttum. Die vielfältigen geschichtlichen Fakten, die mit ihm in Verbindung zu bringen sind, können hier nicht einmal in Andeutungen zur Sprache kommen. Schon 1909 schrieb Muhammad Iqbal (1875–1938), in Europa für seine Bemühungen um die Versöhnung zwischen West und Ost gefeiert, er halte es für unmöglich, den künftig von der britischen Herrschaft befreiten Indischen Subkontinent in einem einzigen Staat zu vereinen; der Islam benötige ein eigenes Gemeinwesen. Muhammad Iqbal wurde so zu einem der geistigen Vorväter des islamischen Pakistan, dessen Regierungen seit der Gründung einen Kurs der immer engeren Bindung jeglicher staatlichen Aktivität an die Scharia verfolgen. Seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre verlor die westliche Zivilisation in der islamischen Welt dramatisch an Strahlkraft. In viele Verfassungen wurde der Grundsatz eingefügt, dass der Islam eine oder gar die eine Grundlage der Gesetzgebung sei. Wenn man in arabischen Ländern seit langem an vielen Hauswänden die Parole „Der Islam ist die Lösung!“ findet, dann muss man in Rechnung stellen, dass viele der muslimischen Zuwanderer nach Europa dem gleichen Gedankengut anhängen und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die sie ja nicht kennen, ablehnend gegenüberstehen. Was für sie wichtig ist, das kann doch nur die Verwirklichung der einzig wahren, der gottgegebenen Daseinsordnung sein, zumal diese, wie man in der islamischen Welt ebenfalls ad nauseam hört, alle – vermeintlichen – Fehler und Frevel der westlichen Zivilisation ausschließt.
Es wäre töricht zu hoffen, dass die in Europa einwandernden Muslime gleichsam von selber zu einer Trennung von Religionsausübung einerseits und Dominierung von Politik und Gesellschaft andererseits fänden. Gewiss gelingt dies manchen unter ihnen, aber der Impuls, „islamisch“ zu bleiben, gerade in der „ungläubigen“ Fremde, ist äußerst mächtig. Die Verbände, mit denen die einheimischen Politiker verkehren, zeigen sich durchweg nicht an einer Anpassung islamischer Glaubensvorstellungen an die westlichen Staaten und Gesellschaften interessiert. Sie nutzen die Bedeutung, die man ihnen einräumt, zu einem Einmarsch in die Institutionen des freiheitlich-demokratischen Staates, um diese ihren Zielen dienstbar zu machen. Diese Ziele sind nichts anderes, als den jahrhundertealten schariatischen Normen Geltung zu verschaffen, die in viele Male überarbeiteten und kommentierten Handbüchern vorliegen. Eine spezifisch „islamistische“ Scharia, eine von den Vorgaben dieser Handbücher abweichende Agenda eines „politischen Islams“ gibt es nicht, ebensowenig einen rein „religiösen“ Islam, der mit den westlichen Verfassungen kompatibel wäre. Die Lehren der Wahhabiten oder der Muslimbrüder rücken diese Traditionen in den Mittelpunkt ihrer machtpolitischen und religiösen Bestrebungen, die in der gegenwärtigen Situation zum einen den westlichen Einfluss auf die islamische Welt zurückdrängen und zum andern die unerwartete Gelegenheit nutzen wollen, den Westen selber zu islamisieren. Dabei treffen sie hier auf mancherlei Entgegenkommen, so etwa, wenn westliche Politiker und Intellektuelle davon reden, man müsse mit dem Islam einen Modus Vivendi „aushandeln“, d.h. das Eigene mit ungewissem Ausgang zur Disposition stellen. Umgekehrt denken die maßgeblichen Autoritäten des Islams daran nicht im Mindesten.
Damit der Westen seine eigene politische und soziale Zivilisation vor den islamischen Herausforderungen bewahren kann, muss er sich zuerst Klarheit über dieses Eigene, in langen schmerzhaften Entwicklungen Errungene verschaffen. Er muss sich ferner dazu aufraffen, die muslimische Minderheit kräftig zu unterstützen, die bereit ist, sich von dem Medinamodell des ewigen Mohammed zu trennen. Der Gesamtheit der Muslime muss offen verdeutlicht werden, dass das in ihren autoritativen Texten überall Durchscheinende, die Gottgegebenheit der Normen und deren hiermit begründeter verpflichtender Charakter, in einer pluralen und freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht gelten können.
Erstveröffentlichung in: TUMULT. Vierteljahreszeitschrift für Konsensstörung. Herausgegeben von Frank Böckelmann, beraten von Egon Flaig und Jörg Friedrich. Dresden, Frühjahr 2020, S. 51-55.