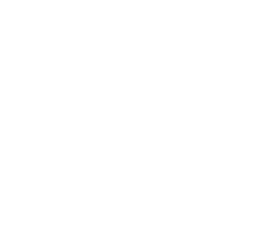50 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei
Anmerkungen zur Umfunktionierung einer kurzsichtigen Fehlentscheidung in einen verklärenden Mythos
Kapitalistischer Arbeitsmarkt und NATO – Wie die Türken nach Deutschland kamen
Infolge der extensiven Wachstumsstrategie in der noch anhaltenden Wiederaufbauphase des westdeutschen „Vollbeschäftigungskapitalismus“ überstieg zu Anfang der 1960er Jahre die Zahl der offenen Stellen die Zahl der Arbeitslosen. Nach dem Mauerbau 1961 drängte deshalb das westdeutsche Kapital aus seiner kurzfristigen Interessenlage verstärkt auf den Import ausländischer Arbeitskräfte. Daraufhin kam es zur Anwerbung von mehrheitlich un- und angelernten Gastarbeitern, die überwiegend in der Schwerindustrie, im Straßenbau und der industriellen Massenproduktion eingesetzt wurden.
Zunächst hatte die christdemokratisch geführte Adenauer-Regierung die Anwerbung von Arbeitskräften nur auf europäische Länder ausgerichtet und die Türkei gar nicht im Blick gehabt. Erst als die Türkei in der damals zugespitzten Phase des Kalten Krieges mit dem eifersüchtigen Argument intervenierte, man wolle als NATO-Land nicht diskriminiert und mit Griechenland gleichbehandelt werden, wurde 1961 auch ein Anwerbeabkommen mit der Türkei vereinbart. Die Initiative zur Einwanderung von Türken nach Deutschland ging also in diesem konkreten Fall nicht von Westdeutschland, sondern von der Türkei aus. Im Endergebnis bildeten Anfang der 1970er Jahre Arbeitsmigranten aus der Türkei (605.000), dem damaligen Jugoslawien (535.000) und aus Italien (450.000) die größten Gruppen.
Zunächst hatte das zuständige Arbeitsministerium unter Führung von Theodor Blank ablehnend bis zurückhaltend auf die türkische Initiative reagiert, da es die konflikthaltige kulturell-religiöse Differenz der türkischen Zuwanderer gegenüber der westdeutschen Aufnahmegesellschaft durchaus als Problem erkannte. Als stärker erwies sich letztlich aber der Druck der Führungsmacht USA, die dem globalstrategisch wichtigen NATO-Partner Türkei zur Seite stand und dessen sozialökonomische Interessenlage unterstützte. So wurde schließlich die Verhandlungsführung vom Arbeitsministerium auf das Außenministerium übertragen und das Abkommen beschlossen.
Das Anwerbeabkommen lag demnach viel mehr im Interesse der Türkei als es deutschen Interessen entsprach, da Westdeutschland ja durchaus auf Arbeitskräfte aus zahlreichen anderen, kulturell-religös weniger differenten Ländern hätte zurückgreifen können. Im Einzelnen ging es dem türkischen Staat um folgende Interessen: Da zwischen 1955 und 1975 die Bevölkerungszahl von 24 auf 40 Millionen gestiegen war – was einem Wachstum von 2,4% jährlich entsprach – hatte (und hat) der türkische Staat ein großes Eigeninteresse an der Auslagerung eines Teils seiner Überbevölkerung. Damit profitierte er zum einen unmittelbar durch die Entlastung des eigenen Arbeitsmarktes und zum anderen zusätzlich durch Deviseneinahmen (Geldüberweisungen der Arbeitsmigranten in die Heimat) sowie durch Gratismodernisierung in Form reimportierter Qualifikationen.
Die langfristigen Folgen eines kurzsichtigen Missverständnisses
Da die ausländischen Arbeitskräfte lediglich als kurz- oder bestenfalls mittelfristiger „Konjunkturpuffer“ bestimmt waren und deshalb von einer nur vorübergehenden Aufenthaltsdauer der Arbeitsmigranten auszugehen war, stellte sich aus der damaligen Sicht der deutschen Aufnahmegesellschaft noch kein integrationspolitisches Problem im heutigen Sinne. Hinzu kamen u. a. folgende restriktive Festlungen des Abkommens:
Die Aufenthaltsdauer sollte im Höchstfall zwei Jahre betragen, eine Anwerbung war ausschließlich für Unverheiratete vorgesehen und ein Familiennachzug bzw. die Familienzusammenführung wurde explizit ausgeschlossen.
Auch die türkischen Gastarbeiter hegten zunächst keine dauerhafte Bleibeperspektive. Bei ihnen handelte es sich überwiegend um anatolische Landflüchtlinge, die erst in die wachsenden Randzonen der türkischen Großstädte wie Istanbul und Ankara übergesiedelt waren und nun in die deutschen Großstädte weiter zogen. Sie gingen davon aus, bald genügend Geld verdient zu haben, um sich dann in der türkischen Heimat eine sichere Existenz aufbauen zu können. Nur im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Aufenthaltsperspektive ertrugen sie das Leben in beengten Sammelquartieren und unter den Bedingungen einer ihnen fremden, säkular-freizügigen Lebenskultur. Sprachliche und soziokulturelle Integration ergab für sie keinen Sinn.
Doch die Rückkehrperspektive verblasste in dem Maße, wie sich in der Türkei aufgrund verschlechterter Wirtschaftsentwicklung, hoher Arbeitslosigkeit und weiter steigendem Bevölkerungswachstum die Lage negativ veränderte. Andererseits entfaltete das westdeutsche Lohnniveau sowie das Sozialversicherungssystem eine starke Sogwirkung. Nun gingen zahlreiche türkische Gastarbeiter dazu über, ihre Familien nachzuholen und sich längerfristig in Deutschland einzurichten. Hatten schon 1968 41 Prozent aller ausländischen Männer ihre Ehefrauen nachgeholt, erleichterte die Bundesregierung 1971 die Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen und entkoppelte damit – mehr oder minder bewusst und im Gegensatz zum ursprünglichen Abkommen – die Zuwanderung von der Entwicklung des Arbeitsmarkts. So war die Gruppe der türkischen Immigranten die einzige, die zwischen 1974 und 1980 von ca. 1,03 Millionen auf 1,46 Millionen anwuchs. Der Versuch, die Zuwanderung an den Konjunkturverlauf und damit an die Bedürfnisse des Kapitals anzupassen, war fehlgeschlagen. Von nun an bestimmten der Familiennachzug und die Kettenmigration – das Nachholen von Verwandten und Freunden – das Zuwanderungsgeschehen. So hatten sich innerhalb von 15 Jahren – vom Schuljahr 1965/66 bis 1980/81 – die Gesamtzahl der ausländischen Schüler verzwanzigfacht: von 35.000 auf 637.000. Insgesamt sind 53 Prozent der ca. 2,5 Millionen Einwohner über den Familiennachzug nach Deutschland gekommen.
Nachdem das Kapital – gestützt auf die willfährige Politik – die „Gastarbeiter“ kurzfristig profitabel als „Konjunkturpuffer“ ausgenutzt hatte, sollte fortan die Gesamtgesellschaft – ohne dass vorher eine demokratische Grundsatzdebatte geführt worden war – für die Folgekosten der akkumulierten Massenzuwanderung aufkommen. Dabei erwiesen sich der nun dominante Familiennachzug und insbesondere der Import von „arrangierten“ Ehepartnern als primäre Quelle der ungesteuerten Zuwanderung von Geringqualifizierten mit einem für das Leben in einer westlich-spätkapitalistischen Gesellschaft „sperrigen“ Sozialisationsprofil. Hinzu kam, dass in diesem vormodernen Kontext die Übersiedlungsmöglichkeit nach Deutschland mit seinem Sozialtransfersystem zum festen Bestandteil des Brautpreises bzw. zum Lockangebot gehört(e) und wohl mit den wichtigsten Bleibegrund darstellt.
Vor diesem Hintergrund entstanden in den ehemaligen Arbeiterbezirken der deutschen Großstädte relativ rasch Zuwandererghettos, in deren tendenziell geschlossenen Sozialräumen sich oftmals sukzessive ein türkisch-muslimischer Kulturimport abspielte. So kam es zum Aufbau eines selbstgenügsamen Netzwerkes von Einrichtungen, die es den Einwanderern gestatten, ihre alltäglichen Lebensvollzüge so weit wie möglich ohne Kontakte mit der einheimischen Gesellschaft zu realisieren.
Zweifellos und erfreulicherweise gibt es auch Fälle von gelungener Integration. Dennoch betreffen diese in den Medien immer wieder überproportional hergezeigten Fälle eine Minderheit. Hinzu kommt Folgendes: Auch wo türkisch-muslimische (und arabischstämmige) Migranten/innen sprachlich und beruflich gut integriert sind und es sogar in politische und wissenschaftliche Ämter geschafft haben, fungieren sie oftmals als Sprecher/innen, Verteidiger/innen und Interessenverfechter/innen einer ethno-religiösen „Kulturgemeinschaft“ mit starker normativer Distanz zur europäisch-säkularen Moderne. Eine echte autoritätskritisch-demokratische Distanz zur eigenen Herkunftskultur ist bei dieser Gruppe hingegen nur sehr selten anzutreffen. Vielmehr dominiert bei ihnen vielfach ein larmoyant zur Schau getragenes Unverständnis gegenüber den wirklichen islamkritischen Beweggründen der nach 1945 geborenen Deutschen.
Jenseits der herkömmlichen Ablenkungs-, Verdrängungs- und Bagatellisierungsrituale, wie sie in der herrschenden Politik und den Medien gang und gäbe sind, geht es aber aktuell und zukünftig um Folgendes:
Kinder aus türkisch-muslimischen Zuwandererfamilien, deren Eltern (a) aus der Unterschicht stammen, (b) einen niedrigen Bildungsstatus aufweisen, (c) gemäß religiös-autoritären („prämodernen“) Prinzipien erziehen und (d) kaum oder nur schlecht Deutsch sprechen, sind in zahlreichen Fällen sozialisatorisch so negativ konditioniert, dass die bereits in der vorschulischen Entwicklung angehäuften und später weiterwirkenden Entwicklungsnachteile durch die Bildungsinstitutionen mitunter noch abgeschwächt, aber nicht mehr kompensiert werden können. Es ist also nicht die soziale Unterschichtzugehörigkeit ‚an sich’, sondern die eigentümliche Verflechtung von sozialen, sprachlichen und religiös-kulturellen Einflussfaktoren, die hier negativ zum Tragen kommt.
Insgesamt betrachtet hat sich damit in Deutschland und europaweit ein immigriertes, bildungsschwaches, sich erweitert reproduzierendes Subproletariat insbesondere islamischer Herkunft herausgebildet, das folgende spezifischen Kernmerkmale aufweist: (a) eine dauerhafte Inanspruchnahme sozialer Transfer-, Unterstützungs- und Förderleistungen der Aufnahmegesellschaft, (b) eine auf Abgrenzung und religiös-kulturelle Identitätspflege bedachte ‚Anerkennungspolitik’ und (c) eine mitunter auch offen zur Schau gestellte Verachtung der säkular-demokratischen Lebenskultur der alimentierenden Aufnahmegesellschaft.
Mit wohlfeilen Redensarten wie „Der Islam gehört zu Deutschland“ und Schau-Auftritten mit sich dreist einmischenden türkischen Politkern wird sich die damit gegebene Problemlage nicht entschärfen lassen.
Ausführliche Analysen zur komplexen Integrationsproblematik finden Sie hier:
Hartmut Krauss: Islam, Islamismus, muslimische Gegengesellschaft. Eine kritische Bestandsaufnahme. Osnabrück 2008.
Hartmut Krauss, Karin Vogelpohl: Spätkapitalistische Gesellschaft und orthodoxer Islam. Zur Realität eines Desintegrationsverhältnisses jenseits von Verdrängung, Verschleierung und Bewältigungsromantik. In: Hartmut Krauss (Hrsg.): Feindbild Islamkritik. Wenn die Grenzen zur Verzerrung und Diffamierung überschritten werden. Osnabrück 2010. S. 217 – 262.