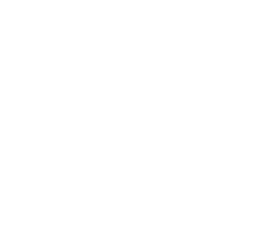Wir müssen über Rassismus sprechen. Was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiss zu sein
Buchbesprechung
Robin J. DiAngelo * Wir müssen über Rassismus sprechen. Was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiss zu sein * Hoffman und Campe, Hamburg 16.07.2020 * Pappband mit SU * 224 S. * Übersetzung: Ulrike Bischoff * ISBN: 978-3-455-00813-5 * 25,00 (D) * 25,70 (A) * 33,90 (CH)
Robin DiAngelo ist genial – ihr Buch ist es nicht.
„White Fragility“ ist bereits zwei Jahre alt, die deutsche Übersetzung aber noch sehr jung, die Ereignisse dieses Jahres wirken sich entsprechend auf die Verkaufszahlen beider Ausgaben aus. Um gleich zu Beginn ein Missverständnis auszuräumen: Es ist keineswegs ein antirassistisches, sondern ein rassentheoretisches Buch. Bei DiAngelo wird die gesamte Menschheit in nur zwei Gruppen eingeteilt: „Weiße“ und „People of Color“. Die letztgenannten treten dabei als grundgute, weise, aber auch einfach strukturierte Charaktere in Erscheinung, Weiße hingegen als tragische und fehlerhafte, dadurch aber eben auch als wesentlich interessantere Lebewesen. Die Festlegung von „People of Color“ als antirassistische Autoritäten bedeutet aber auch zwangsläufig, dass die weiße Autorin DiAngelo selbst keine ist. Ihrer eigenen Logik folgend sollten wir ihr gar nicht zuhören.
Der eigentliche Wirkmechanismus nicht nur dieses Buches, sondern des gesamten Lebenswerks der Autorin ist die Vereinfachung in der Maske der Verkomplizierung. Doch das akademische Catchphrase Dropping verdeckt die inhaltliche Dürftigkeit nur sehr unzureichend. DiAngelo gesteht ein, dass „Rasse“ ja nur ein soziales Konstrukt ist, argumentiert aber anschließend dennoch durchgehend so, als sei es das nicht. Sie räumt ein, dass die Annahme, alle Weißen seien grundsätzlich rassistisch, letztlich auch sie selbst zur Rassistin macht, doch diese Feststellung bleibt konsequenzenlos, denn DiAngelo geht es nicht um Aufarbeitung des eigenen Rassismus, sondern des der anderen. Und wer als Weißer von sich weist, dass er rassistisch ist, befindet sich in einem Zustand der Leugnung.
DiAngelos Thesen sind nicht falsifizierbar. Daher sind sie auch keine wissenschaftlichen Thesen. In ihrer Ideologie wird sowohl zustimmendes wie auch ablehnendes Verhalten als Richtigkeit ihrer Thesen interpretiert – ein alter Taschenspielertrick in neuer Gewandung. Wer abstreitet, rassistisch zu sein, bestätigt dadurch seinen Rassismus. Wer zugibt, rassistisch zu ein, bestätigt ihn natürlich auch. Bleibt die Hexe bei der Wasserprobe an der Oberfläche, dann ist sie auch eine Hexe; geht sie unter – auch gut.
Entsprechend unternimmt DiAngelo auch eher Versuche, ihre Thesen mit Anekdotischem zu belegen als mit Evidenzorientierung. Wie aber nun kommt DiAngelo dazu, zu behaupten, alle Weißen seien Rassisten? Im SPIEGEL mit der Frage konfrontiert, ob die Weißen vielleicht alle einfach von Geburt an Rassisten seien, antwortet DiAngelo: „Nicht qua Geburt. Jeder Weiße ist Rassist durch die Sozialisation in einer rassistischen Kultur.“ Wie es möglich sein sollte, dass alle Weißen der Welt, in unterschiedlichen Kulturen lebend, auf gleiche Weise sozialisiert werden, wird uns an dieser Stelle nicht verraten. Und weiter wird gefragt: „Gibt es einen Weg für Weiße, den eigenen Rassismus zu überwinden? Kann ein Weißer irgendwann sagen, er sei kein Rassist mehr?“ Und weiter wird geantwortet: „Nein, und das wäre auch nicht gut. Wenn ich einigen Weißen diese Möglichkeit eröffne, dann wird sich jeder Weiße darauf berufen.“ Warum aber sollte man das Werk einer Antirassismus-Autorin und Diversity-Beraterin lesen, wenn sie a) laut eigener Aussage selbst rassistisch ist, b) alle Weißen als Rassisten betrachtet und c) diese Dinge ihrer Ansicht nach nicht geändert werden können?
Ganz einfach. Weil die Autorin, im Gegensatz zu ihrem Buch, genial ist.
Im März dieses Jahres kostete ein halbtägiger Workshop, den Robin DiAngelo in Los Angeles veranstaltete, den erwachsenen Teilnehmer 165 Dollar und Kinder 65 Dollar. DiAngelo verdient an einem einzigen solchen Event 10.000 bis 15.000 Dollar, das ist mehr Geld, als die durchschnittliche US-amerikanische schwarze Familie in drei Monaten einnimmt. Man kann also als Weiße gut Geld damit verdienen, darüber zu sprechen und zu schreiben, wie schlecht es Schwarzen geht. Und durch ihre Behauptung, dass der Rassismus nie überwunden werden kann, wird die Geldquelle auch ewig sprudeln. Es wird immer einen Kundenstamm geben, der bereit ist, sich für viel Geld über Rassismus belehren zu lassen. Immer wieder.
Und damit das auch so bleibt, entsteht ein Bestseller: ein bisschen Kafka-Falle, etwas Ursünde, sehr viel Priorisierung von „Rasse“ und sehr viel Anti-Individualismus, Anleitung zum Flagellantentum anstelle des No-Blame-Approach, über das alles dann sehr viel Psycho-Babbel ausgestreut – am Ende sieht es aus dann fast so aus wie akademische Esoterik.
Und so schmeckt es auch.
Thomas Baader, Juli 2020